|
|
 |
|||
FACHBEREICH 16 |
||||
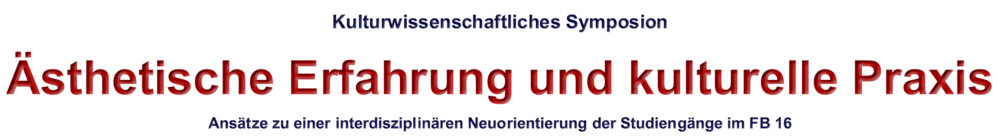
Zusammenfassung der Perspektivenbildung des Symposion
Mit rückblickende Feststellungen über die Kernaussagen der Referenten sollen Pflöcke eingeschlagen werden, um daraus ein gemeinsames Zelt zu bauen:
Hoffmann: Fortschritte in der Entwicklungen des Fachbereichs sind nur mögliche, wenn die Ausrichtung weiter gezielt in der Lehrerausbildung verbleibt und gestärkt wird. Denn die Fächer des Fachbereichs, im wesentlichen "Newcomer" an der Universität, beziehen ihre Daseinsberechtigung im universitären Feld aus der Verlagerung der Lehrerausbildung in den 70-er Jahren von den pädagogischen Hochschulen in die Universität. Er wirft den Hochschullehrende aller Universitäten mangelnde Teilnahme an der öffentlichen Diskussion vor, so dass diese inkompetent wird. Er regt zu mehr Transparenz der Hochschularbeit an und fordert von den Hochschullehrenden ihre Freiheiten, die in der Lehre jetzt schon möglich sind, voll auszuschöpfen. Die Integration der drei Studiengebiete der Lehrerausbildung Fachpraxis, Fachwissenschaft und Fachdidaktik hält er für entscheidend in der Fortentwicklung. Der Nachwuchs in der didaktischen Forschung muss gefördert werden, hier ist ein Mangel festzustellen. Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit müssen u.U. privat-berufliche Bestrebungen zurückgestellt werden.
Selle: Der Fachbereich soll sich fachgrenzenignorierenden Experimenten zuwenden, um die Struktur und den Sinn in der kulturellen Wirklichkeit selber aktiv zu suchen, die Erweiterung der Wahrnehmungsmöglichkeiten und -kompetenzen steht dabei im Vordergrund. Die Orientierung an der Kunst ist mittlerweile obsolet geworden, die aktuelle Kunstszene befindet sich in einem Selbstauflösungsprozess und stellt sich radikal selbst in Frage. Hier kann nur in der engagierten Praxis das Erkenntnisinteresse gestillt werden. Der experimentelle Selbstversuch führt zur eigenen Kompromittierung, nur so sind Erneuerungen möglich. Er fordert auf, eine kulturwissenschaftliche Praxis neu zu erfinden. Eine Haltungsänderungen ist bei den Lehrenden schwieriger als bei Studierenden. Einer traditionellen Bindung der Praxis an die musischen Fächer ist nicht nachzugeben. Die Ästhetik kann nicht an einzelne Fächer delegiert werden, das führt zu einem Legitimationsproblem dieser Fächer. Selle schlägt für die Entwicklungen im Fachbereich eine Beobachtung durch ein externes Team vor. Der Fachbereich sollte eine Praxis entwerfen, die er sich auch zumuten kann. Das reflektive Moment der ästhetischen Praxis ist eines der wesentlichen methodischen Beiträge.
Alkemeyer:
Er stellt das Spiel mit seinen Gestensysteme als eine "Intelligenz des
Leibes" dar. Am Spiel und seinen Gesten lassen sich die Reaktionen auf
gesellschaftliche Zustände in den (neuen) Sportarten registrieren. Das
Spiel ist ein Mnemesis-Konzept, das auch ohne Wort und Schrift auskommt,
es ist als "kulturelle Aufführung" prozesshafter als die Texterstellung.
Kein Spiel läuft ohne einen Verinnerlichungsprozess ab.
Der Spektakelcharakter des Körpers wird zur Aufmerksamkeitserzeugung genutzt,
dabei dient der Medieneinsatz der Selbstreflexion für die Darstellung
des Selbst durch den Körper. (Spiel-)Gerätschaften dienen als Erweiterungen
des Körpers an die Umgebung, um den Körper in seiner Funktion als Sinnes-
und Erfahrungsinstrument zu nutzen.
Fuchs: Die Bestimmung des Kulturbegriffs mit all seinem wissenschaftlichen Hinterbau soll nicht im Vordergrund stehen. Die Begriffe "Kultur" und "kulturelle Bildung" sollten als politisches Schlagwort genutzt werden, und in ihrer öffentlichen Wirkung auch entsprechen eingesetzt werden. Die Schwierigkeit der Fächer des Fachbereichs ist, dass sie sich nicht evaluieren lassen (vgl. z.B. TIMSS), also haben sie in der bildungspolitischen Diskussion einen schweren Stand. Er fordert zum bewussten Umgang mit der Vielfalt auf, die sich im Fachbereich befindet, das kulturelle Feld sollte als ständige Fragestellung und Auftrag verstanden werden, ohne dabei die Fachverantwortung zu verlieren. Neben den didaktischen Gemeinsamkeiten sind auch interkulturelle Gemeinsamkeiten zu suchen, gerade die Fächer im Fachbereich sind dafür geeignet.
Hasse: Sinnliche Wahrnehmung muss im Zusammenhang mit der Rationalität steht. Er fordert ein provokatives Umdenken im Sinne von: "Mit dem Kopf tanzen und mit den Beinen denken". Ästhetische Bildung ist ein plurales Konzept: Erziehung der Wahrnehmung, der Sinne, zur Selbstreflexion, zur Subjektivität, zur Zweckfreiheit, zur Kritik. Ästhetische Erfahrung soll als eine Form des Nachdenkens akzeptiert werden.
Lenger: Den Begriff der Kulturwissenschaft enttarnt er als eine Verlegenheit. Die Verlegenheit hat auch immer etwas mit dem Entlegenen zu tun, dem was Dazwischen liegt. Er betont im Begriff Interdisziplinarität, das "Zwischen", "Inter" als einen Ankerpunkt an dem sich Gemeinsamkeiten und Disziplinen festlegen lassen. "Kulturwissenschaft" ist nicht so sehr eine Disziplin, sondern sollte als Überraschung des Unverfügbaren, das sich ereignet, angesehen werden.
Im Laufe der gemeinsamen Reflexion der Vorträge und der Symposionsdiskussionen entsteht eine Sammlung von Begriffen, die den Teilnehmern als Fixpunkte, als eingeschlagene Pflöcke zur Weiterführung dienen:
Perspektivenbildung
Erkenntnisse

| © Dekanat FB16, 21.03.2001 | | Kontakt | Impressum | Webmaster | |